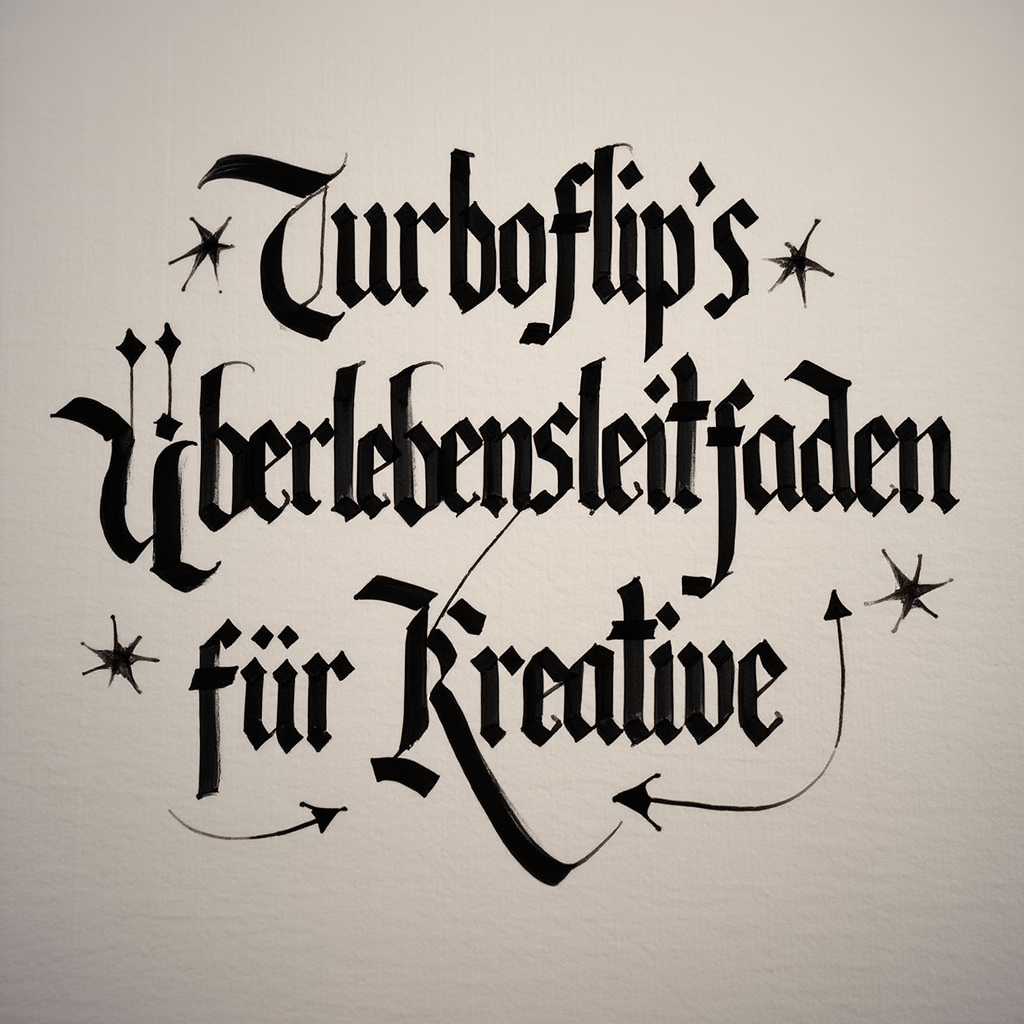
Der „Überlebensleitfaden für Kreative“* ist eine Sammlung von Hilfestellungen für Kreative aller Branchen. In Anbetracht aktuell stattfindender Disruption, die auch bedingt durch die Automation durch generative KI ist, wird notwendig, unser Verständnis davon, was Gestaltung ist, grundlegend zu hinterfragen und neu zu definieren.
*Die Liste wird stetig aktualisiert und präzisiert.
# Finde deine Stimme
Deine einzigartige Perspektive und kulturelle Identität sind dein Kapital. In einer Welt der massenhaften Reproduktion ist die Geschichte, die nur du erzählen kannst, dein wertvollstes Gut. Baue sie aus.
Prof. Dr. Aladin El-Mafaalani („Mythos Bildung“, „Wozu Rassismus“). Er erklärt strukturelle Ungleichheit so, dass man sie fühlt und versteht, ohne entmutigt zu werden.
Theorie der „Narrative Identity“ (Paul Ricoeur): Der Philosoph argumentiert, dass wir unsere Identität durch das Erzählen von Geschichten formen. Deine persönliche Geschichte ist somit keine Anekdote, sondern die grundlegende Struktur deines Selbstverständnisses.
Austin Kleon: „Steal Like an Artist“: Kleon argumentiert, dass nichts völlig originell ist, sondern dass wir durch die Kombination unserer Einflüsse – basierend auf unserer einzigartigen Perspektive – etwas Neues schaffen. „Niemand wird mit einer Stimme geboren. Du findest deine Stimme, indem du arbeitest.“
Marshall McLuhan: „The Medium is the Message“: Erweitert auf den Menschen: Du bist das Medium. Deine kulturelle Prägung, deine Erfahrungen und dein Körper sind das Medium, durch das deine Botschaft gefiltert wird. In einer Welt der Kopien ist das Original du.
# Das Problem verstehen
Bevor du handelst, verstehe den Auftrag im Kern. Was soll warum, für wen und mit welcher Wirkung entstehen? Ohne diese Klarheit schaffst du nur Lärm.
Design Thinking: Diese etablierte Problemlösungsmethode beginnt mit Empathie und Problemdefinition. Ohne eine präzise formulierte Problemstellung (ein „How Might We…?“-Statement) sind alle folgenden Lösungen wahrscheinlich irrelevant.
Simon Sinek: „Start With Why“: Sineks „Golden Circle“ modelliert, dass erfolgreiche Kommunikation und Innovation von der Frage nach dem Warum ausgehen müssen, bevor das Wie oder Was geklärt wird. Das entspricht direkt Ihrer Frage „Was soll warum, für wen und mit welcher Wirkung entstehen?“.
Victor Papanek: „Design for the Real World“: Papanek prangerte schon 1971 sinnloses Design an. Seine Forderung nach sozialer und ökologischer Verantwortung beginnt mit dem tiefen Verständnis des eigentlichen Problems, nicht der oberflächlichen Wünsche des Marktes.
# Selbstwirksamkeit!
Generatives Gestalten ist entkörperlicht. Wir sind es nicht. Bekämpfe die digitale Schwerelosigkeit, indem du Handwerk, Material und Handlung im realen Raum in deine Prozesse integrierst. Spüre die Wirkung deines Tuns.
Embodied Cognition (Theorie der verkörperten Kognition): Diese Strömung in der Kognitionswissenschaft besagt, dass Denken, Lernen und Kreativität nicht nur im Gehirn stattfinden, sondern fundamental mit unserem Körper und seinen Erfahrungen in der Welt verbunden sind. „Entkörperlichtes“ Gestalten ignoriert eine grundlegende Dimension menschlicher Intelligenz.
The Maker Movement & Craftivism: Diese Bewegungen betonen bewusst die physische Herstellung als Gegenpol zur digitalen Entfremdung. Die Arbeit mit Materialien lehrt Demut, Geduld und ein unmittelbares Feedback, das digitale Tools oft abschirmen.
# Sorry: Hinterfrage alles!
Hinterfrage jedes System, jedes Tool, jede Information. Stelle die unbequemen Fragen: Zu welchem Preis? Mit welcher Absicht? Verstehe die Infrastruktur hinter deinen Werkzeugen – ihre ökologischen und geopolitischen Kosten. Definiere deine roten Linien und handle danach. Hinterfrage auch deine eigenen Lösungen: Ist mein gemeinwohlorientiertes Design-Projekt immun gegen Vereinnahmung durch profitorientierte Plattformen?
Kritische Theorie (Frankfurter Schule – Adorno, Horkheimer): Diese Philosophen entwickelten die „Kritik der instrumentellen Vernunft“ – die Frage, ob die Mittel (Tools, Systeme) uns nicht beherrschen, anstatt uns zu dienen, und zu welchen (humanen) Kosten.
Kate Raworth: „Doughnut Economics“: Ein hervorragendes Beispiel für systemisches Hinterfragen. Sie stellt das vorherrschende Wirtschaftsmodell des ewigen Wachstums radikal in Frage und fragt nach seinen ökologischen und sozialen „Kosten“.
Platform & Surveillance Capitalism (Shoshana Zuboff): Zuboff deckt die Infrastruktur und die Absichten hinter den digitalen Werkzeugen auf, die wir täglich nutzen. Ihr Werk ist eine essenzielle Quelle, um die „ökologischen und geopolitischen Kosten“ sowie die versteckten Absichten zu verstehen.
# Kontext ist alles
Kreativität braucht Wurzeln und Flügel. Die Wurzeln: Zeitgeist, Designgeschichte, Psychologie. Die Flügel: Dein kuratorischer Blick, um aus der Ideenflut das wahrhaft Relevante zu erkennen und weiterzuentwickeln.
„Standing on the shoulders of giants“ (Isaac Newton): Das Konzept, dass Fortschritt auf dem tiefen Verständnis des bereits Vorhandenen aufbaut. Die „Wurzeln“ (Geschichte, Theorie) sind dieses Fundament.
Harold Bloom: „The Anxiety of Influence“: Bloom argumentiert, dass starke Künstler sich aktiv mit ihren Vorgängern auseinandersetzen müssen, um ihren eigenen Raum zu finden. Das ist die aktive, kuratorische Arbeit („Flügel“).
# Erkenne Deine blinden Flecken!
Dein Bias ist da. Die Frage ist: Was tust du dagegen? Erweitere aktiv deinen Blick, indem du dir gezielt Kritik von außen holst. Suche die Perspektiven, die dir fehlen.
Kognitiver Bias (Daniel Kahneman, „Schnelles Denken, Langsames Denken“): Kahneman und Tversky haben systematisch die vorhersehbaren Fehler in unserem Denken katalogisiert. Zu wissen, dass diese Biases existieren, ist der erste Schritt.
Intersektionalität (Kimberlé Crenshaw): Dieser theoretische Rahmen zeigt, wie verschiedene Formen der Diskriminierung (Rasse, Klasse, Geschlecht etc.) zusammenwirken und unsichtbare blinde Flecken erzeugen können.
„Principles for Inclusive Design“ (Microsoft/usability.gov): Diese praktischen Guidelines sind operationalisierte Methoden, um blinde Flecken aktiv anzugehen, z.B. durch „Inclusive Design Sprints“ und das Einbeziehen diverser Nutzerperspektiven.
# Wofür verlange ich Geld?
Verkaufe nicht das Bild, sondern die Begründung. Dein Mehrwert liegt im souveränen ästhetischen oder konzeptuellen Bruch, den keine KI generieren kann. Kommuniziere den menschlichen Kontext deiner Entscheidungen – das ist dein Wert.
# Ökonomie designen, nicht nur Dinge
Dein wichtigster Design-Input ist nicht das Briefing, sondern das Geschäftsmodell. Wenn du für NGOs, Kommunen oder Gemeingüter arbeitest, muss deine erste Frage sein: ‚Wie wird dieses Projekt nach der Pilotphase nachhaltig finanziert? Erforsche und prototypisiere aktiv neue Modelle: Wert-basierte Abrechnung, Mitgliedschaftsmodelle (Subscriptions für Gemeingüter), solidarische Gehaltsstufen in Kollektiven. in Projekt, das nicht sein eigenes Überleben sicherstellt, ist kein gelungenes Design, sondern eine temporäre Kunstinstallation.
Arne Gillert („Value-Based Fees“) oder Blair Enns („The Win Without Pitching Manifesto“). Sie zeigen, wie man für Expertise und Wert, nicht für Zeit verkauft.
# Meistere alle deine Werkzeuge
Verstehe die Seele deiner Werkzeuge – ihre Stärken, Grenzen und inneren Klischees. Setze sie bewusst ein und sei transparent im Wie und Warum. Beherrsche sie, damit sie nicht dich beherrschen. Meistern heißt heute vor allem: Verstehe die politische Ökonomie deiner Werkzeuge. Welche Daten füttern die KI, die du nutzt? Welche Weltbilder sind in ihr trainiert? Deine ethische Pflicht ist es, diese ‚Seele der Werkzeuge‘ zu durchschauen und deine Wahl danach auszurichten. Nutze KI, um deine menschliche Urteilskraft zu erweitern, nicht zu ersetzen.
Neil Postman: „Technopoly“: Postman warnt davor, dass wir uns der Technologie unterordnen, ohne ihre kulturellen und sozialen Konsequenzen zu hinterfragen. „Meistern“ bedeutet, die Kontrolle zu behalten.
# Die Macht des spielerischen Forschens
Spielen ist die höchste Form des Lernens. Folge deiner Neugier ohne Angst vor Fehlern. Finde heraus, worin du so aufgehst, dass du die Zeit vergisst. Das ist deine authentische Richtung.
Lev Vygotsky & Jean Piaget: Beide einflussreichen Entwicklungstheoretiker sahen im Spiel eine fundamentale Rolle für die kognitive, soziale und moralische Entwicklung – auch bei Erwachsenen.
Flow-Theorie (Mihály Csíkszentmihályi): Der Zustand, in dem man „die Zeit vergisst“, ist der Flow-Zustand. Csíkszentmihályi identifizierte spielerisches Engagement und eine Balance zwischen Fähigkeit und Herausforderung als Schlüssel zum Flow, dem optimalen Zustand für Lernen und Kreativität.
Stuart Brown: „Play“: Der Gründer des National Institute for Play argumentiert mit neurobiologischen Belegen, dass Spielen für Kreativität, Anpassungsfähigkeit und sozialen Zusammenhalt essentiell ist.
# Resilienz! – Trainiere deine Frusttoleranz
KI-Chaos, Fehlschläge und Manipulation sind garantiert. Deine mentale und physische Gesundheit ist dein strategisches Asset. Sieh Rückschläge nicht als Scheitern, sondern als Daten für deine Weiterentwicklung.
Carol Dweck: „Growth Mindset“: Die grundlegende Psychologie dahinter. Ein „Growth Mindset“ sieht Herausforderungen und Rückschläge als Gelegenheiten zum Lernen („Daten“), während ein „Fixed Mindset“ sie als Beweis für eigenes Versagen interpretiert.
Achtsamkeit (Mindfulness) & Stoizismus: Praktiken wie Meditation und die stoische Philosophie (Seneca, Marc Aurel) trainieren gezielt die Fähigkeit, zwischen einem Ereignis und unserer Reaktion darauf zu pausieren und so unsere Frusttoleranz zu erhöhen.
# Teile!
Kreativität ist ein Teamsport. Tausche Wissen aus, empower andere und lasse dich empowern. Engagiere dich in Communities. Dein Netzwerk ist dein Sicherheitsnetz und dein Resonanzboden. Teilen ist machtvoll. Frage dich: Teile ich nur Ideen, oder teile ich auch Entscheidungsmacht, Credits und Einnahmen? Baue kooperative Modelle (Genossenschaften, DAOs) auf, die Macht institutionalisieren, anstatt sie in netzwerkbasierten Hierarchien zu reproduzieren.
Open-Source-Bewegung: Das vielleicht mächtigste Beispiel dafür, dass das Teilen von Wissen und Code zu robusteren, sichereren und innovativeren Systemen führt als proprietäre, geschlossene Ansätze.
Netzwerk-Theorie: Die Soziologie zeigt, dass schwache soziale Bindungen („Weak Ties“) oft entscheidend für neue Informationen und Chancen sind. Ein aktives Netzwerk ist kein Luxus, sondern ein produktives Asset.
Linus’s Law (Eric S. Raymond): „Given enough eyeballs, all bugs are shallow.“ Dieses Prinzip aus der Software-Entwicklung gilt auch für kreative Prozesse: Ein diverseres Netzwerk sieht mehr „Bugs“ (Fehler, blinde Flecken) und findet bessere Lösungen.
# Neue Auftraggeber, Neue Aufgabenfelder
Die alten Jobs verschwinden. Sieh es als Chance. Die essenzielle Aufgabe der Gestalter:in von heute ist es, aktiv neue, transdisziplinäre Felder zu erschließen und die Rolle des Designs in der Gesellschaft neu zu definieren.Dein neuer Auftraggeber ist vielleicht keine Einzelperson, sondern ein Kollektiv, eine Gemeinde oder ein Stadtviertel. Lerne, für und mit Commons (Gemeingütern) zu designen. Das ist der strukturelle Hebel, um Macht zu dezentralisieren.
Transition Design: Ein wachsender Forschungs- und Praxisbereich, der besagt, dass Designer sich an der Gestaltung eines Übergangs zu nachhaltigeren und gerechteren Zukünften beteiligen müssen. Dies erfordert transdisziplinäres Arbeiten.
Speculative & Critical Design (Dunne & Raby): Diese Praxis erweitert die Rolle des Designers vom Problemlöser zum Fragesteller, der mittels fiktiver Szenarien und Prototypen gesellschaftliche Debatten über Technologie, Werte und Zukünfte anstößt.
Bruce Mau: „MC24: Bruce Mau’s 24 Principles for Designing Massive Change in your Life and Work“: Mau plädiert für einen radikal erweiterten Design-Begriff, der sich mit allem befasst, von globalen Systemen bis zur persönlichen Lebensgestaltung.
Führe ein Doppelleben – Pragmatismus vs. Utopie
Nutze deinen Job, die Schule/dein Studium in der ‚alten‘ Wirtschaft als Labor: Lerne dort Skalierung, Budgetierung und politische Dynamiken. Nutze das Einkommen/Grundsicherung, um 20% deiner Zeit für radikale, gemeinwohlorientierte Experimente zu finanzieren (‚1-Tag-pro-Woche-Protest‘).Diese Dualität macht dich klüger und widerstandsfähiger, als ein reiner Rückzug in die Nische es je könnte.
Welceh guten Quellen dafür?
# Mehr Empathie!
Das Problem, das Kreative bzw. Menschen durch Automaten ersetzt werden ist kein Problem der Technologie. Es zeigt auf ein grundlegendes Problem hin – fehlende Empathie, Neodarwinismus, Neoliberalismus. Ein System sollte den Menschen dienen, nicht die Menschen dem System oder dem Vorteil einiger weniger.
Roman Krznaric: „Empathy: Why It Matters, and How to Get It“: Krznaric argumentiert, dass Empathie eine radikale Kraft für soziale Veränderung ist und dass wir sie durch „empathische Vorstellungskraft“ aktiv kultivieren können.
# Demut.
Entwickle eine Sammlung von Methoden, um sicherzustellen, dass du nicht als „erlösender Designer“ in Gemeinschaften einmarschiert, sondern als dienender Vermittler und Entwickler.
„The Art of Gathering“ von Priya Parker, „Design Justice“ von Sasha Costanza-Chock
# Misch dich ein! Nimm aktiv Teil!
Die Gestaltung von schönen Formen ist nur ein kleiner Aspekt zeitgemäßer Gestaltung . Gestalter:innen sind es gewohnt komplexe Probleme zu durchdringen und Lösungsansätze zu entwickeln und zu erproben und vielseitige Perspektiven auf eine Sachlage aufbereiten zu können. Schärfe diese Kompetenz und setzte sie ein – und mische Dich aktiv in Dialoge und Diskurse – lokal und international – ein.
(Politik & Design): Fiona Raby & Anthony Dunne („Speculative Everything“) für das Infragestellen von Systemen durch Design. Civic Design / Public Interest Design als konkrete Praxis.
Praktische Leitplanken
Was wäre wenn…
Was denken Sie? Wie sollte Ihre Lebenswelt beschaffen sein? z.B. Was verstehen Sie unter Arbeit? Wie wünschen Sie sich ein lebenswertes Zusammenleben? Wie sollten wir mit natüürlichen Ressourcen umgehen? – Alles ist möglich! Nehmen Sie ihre Vorstellung als Horizont und Ausgangspunkt für Ihre Gestaltungsreise.
Die Konkretheits-Frage
Sie wollen „die Demokratie stärken“ oder „Gleichberechtigung fördern“. Anstatt als Ziel ein riesiges Konzept oder wissenschaftliche Abhandlung zu erarbeiten: Können Sie nächste Woche ein einfaches Tool entwerfen, das die Tagesordnung der nächsten Gemeinderatssitzung für 15-Jährige verständlich macht? Die Reaktion darauf gibt Ihnen echtes Feedback. Die Herausforderung dabei ist, den Horizont nicht aus dem Auge zu verlieren und aus der Stoßrichtung kleine, nachvollziehbare Maßnahmen zu destillieren.
Die Machtfrage
Wenn Sie ein co-designetes Stadtteilprojekt planen – verschiebt es Macht strukturell zu den Bewohnern (z.B. durch Entscheidungsbudgets, Eigentumsrechte), oder ist es nur eine konsultative Alibi-Übung, die die Verwaltung entlastet, ohne reale Macht abzugeben? enn die Antwort ist „Wir Designer fühlen uns besser, weil wir Gutes getan haben“, ohne dass sich die Machtverhältnisse für die Beteiligten ändern, ist es Eskapismus.
Ihr könnt die Werkzeuge für faire Teilhabe designen. Ihr könnt aber nicht die Macht umverteilen. Das ist ein politischer, oft konfliktreicher Akt. Die Grenze ist erreicht, wenn euer schön designedes Beteiligungsportal von der Verwaltung ignoriert wird. Dann müsst ihr euch entscheiden: Akzeptieren wir das? Oder wechseln wir die Taktik und designen nun Werkzeuge des Protests und des Drucks? Das ist der Punkt, an dem Gestaltung auf Aktivismus trifft.
Die Skalierungsfrage
Sie entwerfen eine lokale Tauschökonomie. Kann sie wachsen, ohne dass am Ende ein Venture-Kapital-gestütztes Platform-Unternehmen kommt, sie kopiert und alle Wertströme abschöpft? Wenn Ihr Modell nur funktioniert, solange es klein und unbedeutend bleibt, ist es ein schönes, aber letztlich wirkungsloses Experiment.
Die Ökonomie Frage
Ihr Sozialdesign-Projekt wird von einer Stiftung finanziert. Was passiert, wenn die Förderung ausläuft? Schafft es reellen, messbaren Wert für jemanden, der bereit ist, direkt dafür zu zahlen (sei es eine Kommune, die Kosten spart, oder eine Gemeinschaft, die einen klaren Vorteil sieht)? Oder ist es ein „Gutmenschen-Produkt“, das ohne Subventionen sofort kollabiert? Wenn das Finanzierungsmodell nicht Teil des eigentlichen Designs ist, ist es Kunst, nicht Design.
Die Implementierungsgrenze
Ihr entwerft den perfekten partizipativen Prozess für ein Stadtviertel. Seine Umsetzung erfordert politischen Willen, Haushaltsentscheidungen und Verwaltungshandeln. Ihr habt keine exekutive Macht. Eure Rolle endet mit dem überzeugenden, getesteten Prototypen und der Empfehlung. Die Macht, ihn umzusetzen, liegt bei anderen.
Die Expertisengrenze
Ihr könnt ein System zur fairen Verteilung von Wasser in einer Gemeinde co-designen. Aber ihr seid keine Hydrolog:innen, Bauingenieur:innen oder Jurist:innen für Wasserrecht. Eure Rolle ist die der Übersetzer:in und Facilitator:in, die das Wissen aller Beteiligten so zusammenführt, dass eine tragfähige Lösung entsteht. Ihr stellt die Fragen, formuliert die Optionen visualisiert die Konsequenzen – aber ihr entscheidet nicht fachfremd.